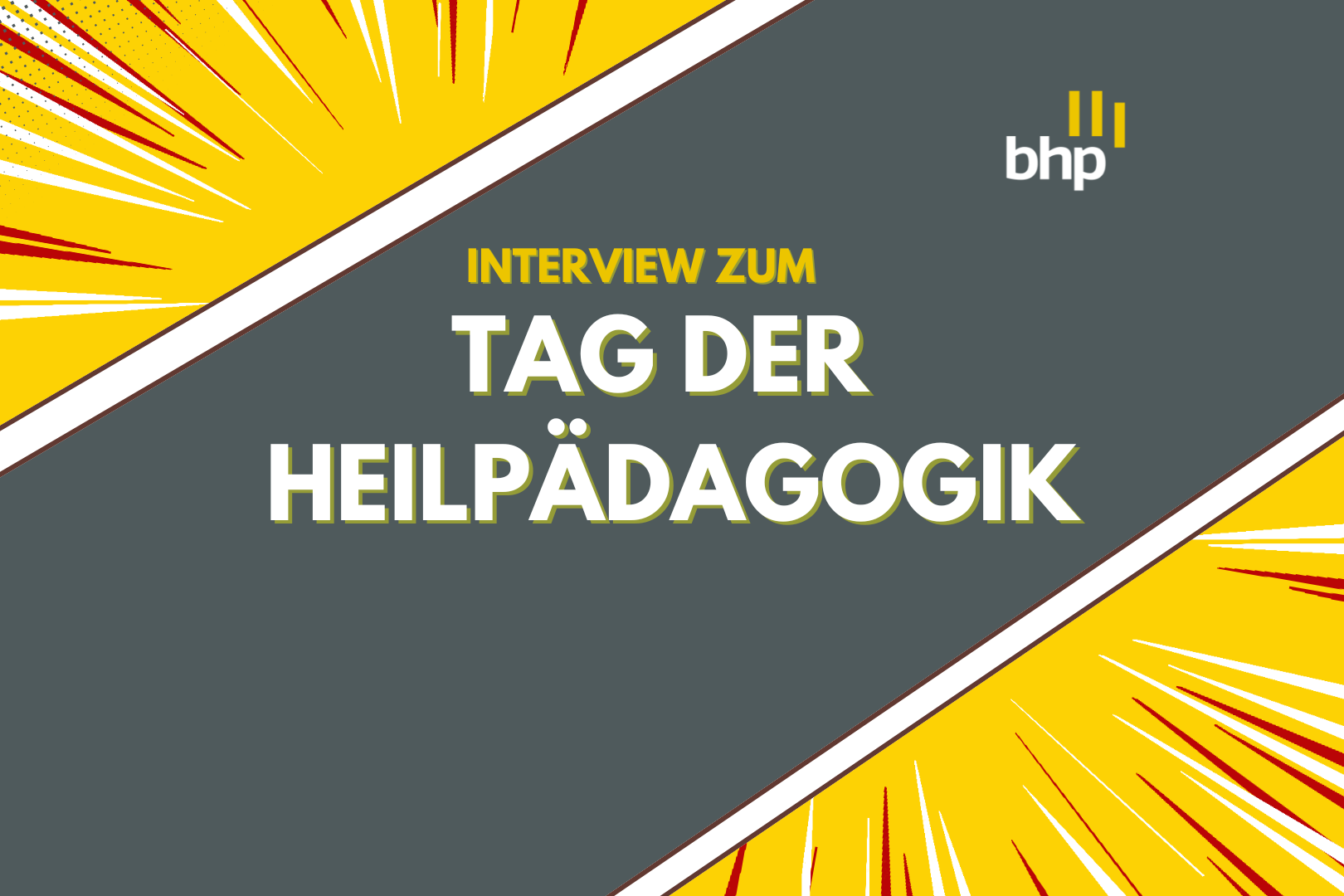Jedes Jahr am 13. April wird der Internationale Tag der Heilpädagogik begangen. Ziel des Aktionstages ist es, die Profession zu stärken und die Heilpädagogik in der breiten Öffentlichkeit darzustellen. Zu diesem Anlass sprachen wir mit Prof. Dr. Jeanne Nicklas-Faust, Bundesgeschäftsführerin der Bundesvereinigung Lebenshilfe, über aktuelle gesellschaftliche und politische Entwicklungen der Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchtigung.
Sehr geehrte Frau Nicklas-Faust, seit mehr als 14 Jahren sind Sie Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Welche politischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen waren in dieser Zeit bedeutsam für eine gleichwertige Lebensbeteiligung von Menschen mit und ohne Behinderung?
Jeanne Nicklas-Faust: „Als Erstes würde ich hier die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) nennen: Sie ist vor 16 Jahren für Deutschland ratifiziert worden und stellt seitdem einen Maßstab für die Weiterentwicklung der Unterstützung für Menschen mit Behinderung dar. Auch wenn es an vielen Stellen bedrückend langsam vorangeht, ist sie doch eine Messlatte vor allem für staatliches Handeln. Auch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) hat mit der umfassenden Bedarfsermittlung und Einführung der Personenzentrierung wichtige Impulse für die gleichberechtigte Teilhabe und individuelle Unterstützung für Menschen mit Behinderung gegeben. Allerdings ist auch hier die Umsetzung sehr mühsam und lange nicht vollständig. Gleichzeitig hat sich durch die Coronapandemie gezeigt, wie leicht Menschen mit Behinderung aus dem Blick geraten und wie unzureichend inklusive Strukturen in Deutschland ausgeprägt sind. Insofern ist es nötiger denn je, sich für Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe einzusetzen, wenn jetzt angesichts leerer Kassen bei Menschen mit Behinderung und ihrer Teilhabe gespart werden soll.“
Noch im Juni 2024 gab es auf dem Treffen der G7-Staatsund Regierungschefs erstmals ein Bekenntnis zur Inklusion. Mit dem Amtsantritt von Donald Trump, der sich mehrfach ableistisch geäußert hat und bereits als erste Amtshandlung Maßnahmen für Diversität, Gleichstellung und Inklusion in Bundesbehörden gestoppt hat, und dem europaweiten Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien zeichnet sich für die Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsbewegung in den USA und Europa ein erheblicher Rückschlag ab. Welche Auswirkungen kann dieser Trend nach Ihrer Einschätzung für die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen in Deutschland haben?
Nicklas-Faust: „Tatsächlich kann man den Eindruck haben, dass diese Tendenzen Leitbilder ändern könnten und statt Inklusion wieder eine Separierung von Menschen mit und ohne Behinderung stärken. Dies entspricht einem Trend, den man international beobachten kann – auch in den skandinavischen Staaten, die lange als Vorbild galten. Eine noch größere Gefahr sehe ich allerdings in den Einsparungen in der Eingliederungshilfe, die sich aktuell in verschiedenen Bundesländern zeigen – zum Beispiel mit Mindestgrößen von Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung, die der Deinstitutionalisierung entgegenstehen, oder als besonders extremes Beispiel in der Kündigung des Landesrahmenvertrages in Sachsen-Anhalt. Im Zusammenwirken von Sparbemühungen und dem Zurückfahren von inklusiven Entwicklungen droht aus meiner Sicht ein wirklicher Rückschritt, der die Teilhabe von Menschen
mit Behinderung eher vermindert, als sie entsprechend der UN-BRK gleichberechtigt auszugestalten.“
Die im November 2024 gescheiterte Ampelregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag (2021–2025) vereinbart, das Behindertengleichstellungsgesetz, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zu überarbeiten. Welche dieser Vorhaben sind gelungen?
Nicklas-Faust: „Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie wurde verabschiedet und bringt für Produkte und Dienstleistungen mehr Barrierefreiheit für Verbraucherinnen und Verbraucher. Auch eine kleinere Anpassung des AGG ging in diese Richtung. Als Lebenshilfe hatten wir allerdings auf eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) und des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) gesetzt, die neben öffentlichen Stellen auch private Anbieter zur Barrierefreiheit verpflichten würde – und obwohl aus dem Bundessozialministerium immer wieder übermittelt wurde, dass es bereits einen solchen Entwurf des BGG gebe, kam es nicht zur einer Verabschiedung und somit auch nicht zu dringend überfälligen Fortschritten in der Barrierefreiheit.“
Vom Bruch der Bundesregierung im November 2024 ist unter anderem die Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfeinklusionsgesetzes (IKJHG) betroffen, das eigentlich bis zum Sommer 2025 verabschiedet werden sollte. Der Reformprozess in der Kinder- und Jugendhilfe ist damit in dieser Legislaturperiode gescheitert und eine Umsetzung erst nach Wiederaufgreifen durch eine neue Bundesregierung möglich. Was muss aus Ihrer Sicht im IKJHG geregelt werden, damit eine tatsächlich inklusive Kinder- und Jugendhilfe gelingen kann?
Nicklas-Faust: „Damit eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe gelingt, muss eine entsprechende Finanzierung der Jugendämter und freien Träger sichergestellt werden. Der Zuständigkeitswechsel als Verwaltungsreform kann nur dann erfolgreich sein, wenn finanziell gewährleistet ist, dass Kinder mit Behinderung und deren Familien die für sie erforderlichen individuellen Leistungen als Nachteilsausgleich erhalten und die Zuzahlungen entfallen. Entscheidend ist dabei für uns die Einbeziehung aller Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen. Damit einhergehend muss es die Verpflichtung der öffentlichen Jugendhilfe zum Vereinbarungsabschluss im Bereich der ambulanten Leistungen und den Erhalt der Schiedsstellenfähigkeit geben. Schließlich wäre die Regelung einer einheitlichen Gerichtsbarkeit für alle Leistungen im SGB VIII in der Sozialgerichtsbarkeit wichtig.“
Am 01.08.2026 tritt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter in Kraft. Im Moment müssen in den Ländern und Kommunen große Anstrengungen darauf verwendet werden, die entsprechenden Kapazitäten aufzubauen. Wie kann erreicht und sichergestellt werden, dass auch Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen diesen Rechtsanspruch vollumfänglich nutzen können?
Nicklas-Faust: „Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung brauchen in der Ganztagsbetreuung hinreichend qualifizierte Betreuungskräfte, um vorbehaltslos teilnehmen zu können. Daher ist es erforderlich, dass ein Teil der Erzieher:innen über Qualifikationen beziehungsweise Weiterbildungen im Bereich Inklusion verfügt und gegebenenfalls die personelle Ausstattung erhöht wird. Ergänzend könnte es sinnvoll sein, die bereits vorhandene Expertise und Erfahrungen aus der Schulbegleitung zu nutzen, um eine inklusive Gestaltung zu gewährleisten.“
Anlass dieses Interviews ist der Internationale Tag der Heilpädagogik, der am 13. April dieses Jahres zum vierten Mal begangen wird. Was verbinden Sie persönlich mit dem Beruf des/der Heilpädagog:in?
Nicklas-Faust: „Zunächst verbinde ich den Beruf der Heilpädagog:in mit vielen Menschen, die ich über die Begleitung meiner Tochter Eva kennengelernt habe, die mit komplexer Behinderung lebt. Hier hat mich zumeist die Verbindung von fachlicher Expertise und besonderen Persönlichkeiten beeindruckt.“
Die Heilpädagogik ist überall dort gefragt, wo Menschen jedes Alters aufgrund von sozialem Ausschluss, Beeinträchtigung oder (drohender) Behinderung vor Entwicklungs- und Teilhabebarrieren stehen. Welche Rolle nehmen soziale Berufe wie die Heilpädagogik in Ihrer Wahrnehmung bei dem Abbau gesellschaftlicher Barrieren ein? Was müsste sich in den sozialen Berufen gegebenenfalls ändern, um den Abbau von sozialen oder gesellschaftlichen Barrieren zu beschleunigen?
Nicklas-Faust: „Die sozialen Berufe, die in der Begleitung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung tätig sind, sind vor Ort oft in der Lage, Barrieren abzubauen, indem sie für die Menschen, die sie begleiten, Möglichkeitsräume für Aktivitäten schaffen und Begegnungen unterstützen. So tragen sie zu persönlichen Erfahrungen im Sozialraum bei, die eine Beseitigung von sozialen Barrieren befördern, zum Beispiel dadurch, dass Menschen mit Behinderung als Mitbürger:innen wahrgenommen werden, an die auch gedacht wird, wenn Aktivitäten geplant werden. Die strukturellen Barrieren abzubauen, ist dagegen viel schwerer und erfordert eine systematische Herangehensweise, zum Beispiel durch Aktionspläne, die gezielt Maßnahmen zum Abbau von Barrieren verbindlich machen. Hier könnte eine Zuwendung zu allgemein gesellschaftlichen Aufgaben jenseits des individuellen Tätigkeitsfeldes und der jeweiligen Anbindung im Sozialraum hilfreich sein.“
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Prof. Dr Jeanne Nicklas Faust ist Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.

Prof. Dr. Jeanne Nicklas-Faust
© Lebenshilfe Chaperon